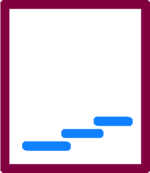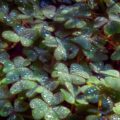Leid, Rausch und Weltruhm
von Wolf-Dieter Müller-Jahncke und Angela Reinthal, Heidelberg
Alkohol, Morphin, Kokain: Große Schriftsteller von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann bis Hans Fallada, von Friedrich von Hardenberg bis Georg Trakl, von Joseph Roth bis Uwe Johnson, von Hemingway bis Faulkner, haben sich der Sucht hingegeben, ja, waren zum Teil erst mit Hilfe des Drogenkonsums zu ihren literarischen Spitzenleistungen, die sie weltberühmt gemacht haben, fähig.
Der folgende Beitrag der Pharmazeutischen Zeitung ermöglicht einen Streifzug durch das Schrifttum Berliner Literaten. Dieses steht synonym für Leid und Rausch, ohne die große Literatur vielfach nicht entstanden wäre.
Es handelt sich um einen berarbeiteten Vortrag, gehalten in Berlin am 9. Oktober 2002 auf dem Vorsymposium »Pharmazie in Berlin« der FG Geschichte der Pharmazie der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft.
Spitzenleistungen durch Doping
Während der Begriff »Sucht« medizinisch eingrenzbar erscheint, kann man dies von dem Begriff »Sehnsucht« nicht behaupten. An dieser Stelle enthalten wir uns jeglicher Definitionsversuche und bemühen auch keine semiotischen Feinheiten, sondern lassen – im Zeitalter von »pharmaceutical care« und »compliance« bewusst »political incorrect« – den »Verbraucher«, sprich: Drogenkonsumenten, zu Wort kommen. Wir stellen also ein »Cento« von Texten vor, eine subjektiv ausgewählte Collage, durch die Sie – »literary correct« – der Sohn eines Apothekers führen wird, der sich, obgleich ein bedeutender Entomologe, als Schriftsteller einen Namen gemacht hat: Ernst Jünger.
Jünger, 1895 in Heidelberg geboren und 2001 im schwäbischen Wilflingen verstorben, wuchs in Hannover auf und studierte Zoologie sowie Philosophie in Leipzig und Neapel, ehe er, nach dem Ersten Weltkrieg, als Literat reüssierte (1). Seine Erfahrungen mit fast allen Arten der Sucht hat er in seinen Essays „Annäherungen“ niedergelegt (2), und so kann er als bewanderter »Cicerone« durch dieses Feld menschlicher Leidenschaft und Leidensfähigkeit sicher führen.
Wie Jünger werden auch wir nicht alle Arten der Sucht streifen und die Freunde der »Grünen Fee«, des Haschischs, mit dem Jünger experimentiert hat, oder des Opiums, das bereits zu Jüngers Zeit demodé war, enttäuschen müssen. Auch bleiben wir im Großen und Ganzen in Jüngers Zeitalter, denn alle übermäßigen Trinker von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann bis Hans Fallada und alle Opiumsüchtigen von Friedrich von Hardenberg bis Georg Trakl, die sich nicht ohne Erfolg zur »schreibenden Zunft« zählten, können hier nicht vorgestellt werden. So bleibt, durchaus in der Erkenntnis, dass das »Leitbild einer von legalen und illegalen psychoaktiven Substanzen freien
Gesellschaft« an der Realität scheitern muss (3), eine subjektive Auswahl von Alkoholsüchtigen, Morphinisten und Kokainsüchtigen im Berlin der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dabei finden sich teils distanzierte Beobachter der »Szene«, teils Experimentierfreudige und großenteils Suchtkranke, die wähnten, ihr Genie mit Hilfe von psychedelischen Substanzen zu literarischen Spitzenleistungen dopen zu können.
Übermäßiger Alkoholkonsum
Jünger schilderte in seinen „Annäherungen“ (4) den Effekt des Alkoholkonsums so:
»Der Einfluß der Droge ist ambivalent; sie wirkt sowohl auf die Aktion wie auf die Kontemplation: auf den Willen wie auf die Anschauung. Diese beiden Kräfte, die sich auszuschließen scheinen, werden oft durch dasselbe Mittel hervorgerufen, wie jeder weiß, der einmal eine zechende Gesellschaft beobachtet hat. Allerdings ist es fraglich, ob man den Wein zu den Drogen im engeren Sinne rechnen kann. Vielleicht wurde seine ursprüngliche Gewalt in Jahrtausenden des Genusses domestiziert.«
In seinem feuilletonistischen Essay „Alkohol und Literatur“ (5) beschrieb Michael Krüger das Verhältnis zwischen Stimulans und Ergebnis wie folgt:
»Wer schreibt, trinkt auch. Was man den kargen Dichtergräbern nicht ansieht, wird deutlich, wenn man die nicht-kanonisierten Werke, die Briefe und Tagebücher der Autoren studiert: Ein Alkoholnebel liegt über der Weltliteratur. Es ist für manche ein erhebliches Ärgernis, daß die großen Werke sich auch dem Alkohol verdanken, für andere ist es tröstlich: In dem seltsamen Mann, der da seit dreißig Jahren mit der Bierflasche auf dem Sofa hockt, steckt vielleicht doch ein unsterbliches Genie. Goethes Weinkonsum ist penibel festgehalten, E. T. A. Hoffmanns Fahne bekannt, die Tatsache, daß „the Great American Novel“ von Hemingway bis Faulkner eine schwimmende Grundlage aus Whiskey hat, wird sich herumgesprochen haben, und auch die große deutschsprachige Literatur der Gegenwart – von dem armen Trinker Joseph Roth bis zu Uwe Johnson – wäre ohne Alkohol nicht denkbar.«
1. Nehmen Sie regelmäßig vor der künstlerischen Arbeit Alkohol in irgendeiner Form zu sich, und welche Wirkung schreiben Sie dem zu?
2. Haben Sie, falls Sie nicht regelmäßig Alkohol vor der Arbeit nehmen, es aber gelegentlich doch einmal getan haben, dann eine Steigerung oder eine Hemmung Ihrer Arbeitsleistung beobachtet?
3. Sehr dankenswert wäre eine Mitteilung Ihres Standpunktes zur Alkoholfrage im Allgemeinen, besonders aber Ihre Beobachtung über die Wechselwirkung zwischen Alkohol und Dichtung.
Die Antworten fielen eher zu Ungunsten des Alkoholkonsums aus. Der Essayist und Kulturphilosoph Alexander von Gleichen-Rußwurm (1865 bis 1947) schrieb aus München: »Ihre freundliche Frage, ob ich dem „stillen Suff“ ergeben bin, muß ich mit „nein“ beantworten.«
Thomas Mann (1875 bis 1955), ebenfalls München, bemerkte hingegen etwas ausführlicher:
»Es ist ganz gegen meine Gewohnheit, vor der Arbeit oder während der Arbeit Alkohol zu mir zu nehmen. Dennoch ist das ein paarmal vorgekommen. Während ich seit langem nur noch vormittags arbeite, habe ich vor Jahren einmal eine Novelle zur Abendzeit geschrieben und zwar unter Mithilfe von Kognak-Grog. Man merkt’s ihr an. Ferner habe ich einmal, als ich eine Termin-Arbeit (sie sind schrecklich, diese Termin-Arbeiten) durchaus noch nachmittags fertig machen mußte, eine halbe Flasche Champagner hinzugezogen, die mich wirklich bis zur Beendigung der Novelle am Schreibtisch festhielt. Aber es handelte sich dabei weniger um Stimulation, als um Beruhigung. Der Wein lähmte mir Ungeduld und Ueberdruß, machte mich still und verhinderte, daß ich davon lief. Das ist alles.«
Abhängigkeit von Morphin
Verlassen wir das Thema »Alkoholismus«, zumal sich keine heute noch bekannten Berliner Literaten unter den Befragten fanden, und stürzen uns ins Berlin der 20er-Jahre, in dem nicht nur fleißig getrunken, sondern auch »gespritzt« und »gekokst« wurde. Nach der Entdeckung des Morphiums durch Friedrich Wilhelm Sertürner (1783 bis 1841) hatte sich dieses Alkaloid vor allem durch die Erfindung der Injektionsspritze von Charles-Gabriel Pravaz als Schmerzmittel durchgesetzt – und mit ihm auch die Abhängigkeit. Schon Christoph Wilhelm von Hufeland (1762 bis 1836), Leibarzt am preußischen Hofe und Arzt an der »Charité«, hatte in Analogie zur »Trunksucht« den Begriff der »Opiumsucht« geprägt (3), der später wiederum analog auf den »Morphinismus« oder die »Morphomanie« übertragen wurde. Bereits die subkutanen Injektionen in den Kriegen des 19. Jahrhunderts hatten zu verstärkter Abhängigkeit geführt, deren wahre Bedrohung aber erst nach dem Ersten Weltkrieg erkannt wurde. Man machte die in diesem Krieg bei Kriegsverletzten applizierten und rezipierten viel zu hohen Dosen von Morphin für die Sucht verantwortlich, die sich in den 20er-Jahren weiter ausbreitete, da der Morphiumbestand des Heeres teilweise auf den illegalen Markt drängte. Auch die katastrophale wirtschaftliche Lage während der Hyperinflation ließ die Nachfrage nach Morphin steigen, und 1928 registrierte man 6356 Fälle von Morphinabhängigkeit (7).
Doch lassen wir wieder unseren »Cicerone« Ernst Jünger zu Wort kommen, der scharfsinnig bemerkte (4):
»Wer sich betäuben will, verhält sich anders als jener, der sich nach Art der Schwärmer zu berauschen gedenkt. Er sucht nicht die Gesellschaft, sondern die Einsamkeit auf. Er steht der Sucht näher, daher pflegt er sein Tun zu verbergen, dem auch die festliche Periodik fehlt. Der „heimliche Trinker“ gilt als bedenklicher Typ. Wer sich schwer und gewohnheitsmäßig betäubt, ist schon deshalb auf Heimlichkeit angewiesen, weil die Droge fast immer aus dunklen Quellen stammt. Ihr Genuß führt in eine Zone der Illegalität. Es gehört daher zu den Anzeichen beginnender Anarchie, wenn derart Berauschte die Öffentlichkeit nicht mehr scheuen. So konnte man nach dem Ersten Weltkrieg in den Cafés Drogierte beobachten, die dort `Löcher in die Luft starrten´.«
Indessen hielt sich kaum einer der abhängigen Literaten allein an Morphin, häufig wurde daneben auch Kokain geschnupft, das überall an dunklen Plätzen in Berlin erhältlich war. Kokain hatte seit den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts zur Entwöhnung von Alkoholikern und Morphinisten gedient und war auch von Sigmund Freud dazu empfohlen worden. Eine Therapie erschien aussichtsreich, denn »unzählige derartige Kuren, welche zu raschem und glücklichem Ende führten, haben uns bewiesen, dass Cocain bei der Behandlung der Morphomanie nicht mehr zu entbehren ist« (7).
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein Höhepunkt des Kokainverbrauchs festgestellt, und Hans W. Maier schrieb in seinem Werk „Der Kokainismus. Geschichte/Pathologie. Medizinische und behördliche Bekämpfung“, das 1926 in Leipzig erschien (8): »In Deutschland und Österreich war es die Revolutionszeit von 1918/19, die in doppelter Richtung der Ausbreitung des Kokainschnupfens Vorschub leistete. Einesteils schuf die neurotisch-psychopathische Stimmung, die ganze Bevölkerungsklassen, besonders der Großstädte, ergriff, den Boden und das Bedürfnis nach narkotischen Mitteln, […] andernteils kamen durch die ungeregelte Auflösung der Truppenbestände und des Heeresmaterials große Mengen von Arzneistoffen […] unter die Bevölkerung.«
Bekanntschaft mit Kokain
Folgen wir auch hier Ernst Jünger, der selbst mit Kokain Bekanntschaft machte, die er unter der Überschrift „Weisse Nächte“ (4) zusammenfasste:
»Beim Kokain fällt mir Bodo ein, ein Altersgenosse, den ich nach dem Ersten Weltkrieg kennenlernte und bewunderte […]. Bodo hatte mir die Luzidität gerühmt, die der Stoff vermittele. Sie führe zu guter Übersicht, klaren Entscheidungen. Ich solle es versuchen; die Feder würde über das Papier fliegen. Das ließ ich mir nicht zwei Mal sagen; sein Freund, der Arzt, der auch zu den Adepten zählte, gab mir ein blaues Schächtelchen vom Umfang eines Fünfmarkstücks und ein Glaslöffelchen dazu. Eines Abends schloß ich mich damit ein.«
Kokain war ebenso leicht käuflich wie Morphin; dies zeigen die Erinnerungen von Paul Ernst Marcus, der unter der Sigle »PEM« veröffentlichte. Marcus, 1901 in Beeskow/Brandenburg geboren, versuchte sich zunächst als Devisen-Arbitrageur (heute: Analyst) in Mannheim und Berlin, begann aber während der 20er-Jahre journalistisch zu arbeiten. 1933 emigrierte er über Prag nach Wien, 1936 nach London, wo er 1972 verstarb. Sein bekanntestes Werk „Heimweh nach dem Kurfürstendamm“ veröffentlichte er 1952 in Berlin (9) . Marcus schreibt:
»Wir gingen über die Halenseer Brücke ins „Elfenschloß“ oder in die „Rote Mühle“, um unsere ersten Tanzschritte zu wagen. Und taten noch viele Dinge, die selten Spaß machten, aber den magischen Reiz des Verbotenen hatten. “Kokain gefällig?“ flüsterten Händler, den Kragen hochgeschlagen, auf den abendlichen Straßen. Die bis dahin in Berlin wenig bekannte Droge wurde gleich berolinisiert und hieß nun „Koks“. Wollte man aus Neugier auch einmal koksen, bekam man für fünf Mark ein wie ein Arzneipülverchen verpacktes Etwas in einem Hausflur in die Hand gedrückt. Man schnupfte das weiße Zeug verstohlen. Oft verspürte man keinerlei Wirkung, weil das „Koks“, das auch „Schnee“ hieß, nur Kartoffelmehl oder Kalk war.«
Mutter, der Mann mit dem Koks ist da
»Mutter, der Mann mit dem Koks ist da.
Junge, halts Maul, ich weiß es ja.
Hab ich denn Geld? Hast du denn Geld?
Wer hat denn den Mann mit dem Koks bestellt? […]«
Berliner Gassenhauer (10)
Auch der Mainzer Literat Carl Zuckmayer (1896 bis 1977), eigentlich der Spezies »Alkoholiker« zuzuordnen, versuchte sich als Kokainhändler – oder besser als »Kleindealer«. In seinen Erinnerungen „Als wär‘s ein Stück von mir“ (11) schildert der Autor des „Fröhlichen Weinbergs“, wie er in seiner Berliner Zeit aus finanzieller Not zum Kokainvertrieb griff:
»Eines Abends versetzte mich plötzlich mein Chef – vielleicht um mich in eine höhere Gehaltsklasse hinaufzuprotegieren, vielleicht weil ich als Schlepper nicht sonderlich begabt war – in den Westen, in die Gegend des Wittenbergplatzes. Er brachte mich selbst in einem Taxi zur Tauentzienstrasse und füllte mir die Taschen mit einigen Zigaretten- und Zigarrenpäckchen, vor allem aber mit kleinen gefalteten Quadraten aus weißem Papier, wie man sie damals bei Apothekern für Kopfwehpulver bekam.
Er gab mir eine kurze, hastige Anweisung, wie ich damit zu agieren habe: ich solle nur langsam auf der Straße auf- und abgehen, vor mich hinsprechen »Zssigarren, Zssigaretten« – mit einem scharf zischenden S-Laut. Das sei das Merkzeichen für meine Kunden, die sich ihrerseits durch Schnüffeln mit der Nase kenntlich machten […]. Auf meine Frage nach dem Inhalt sagte er »Schnee« und fügte noch beruhigend hinzu, in Wirklichkeit sei es nur Kochsalz, mit zerstoßenem Aspirin vermischt, also eigentlich kaum strafbar […].«
Drogendichtung
Zweifellos gibt es eine Typologie der Abhängigen: Hier sollen ein literarischer Analytiker, zwei polytoximane Dichter und eine Tänzerin vorgestellt werden.
Wie kaum ein anderer konnte der Arzt Gottfried Benn (1996 bis 1956) seine Experimente mit Drogen aller Art, darunter auch Kokain, in dichterische Form gießen. Nach seiner Promotion im Jahre 1912 mit der Dissertationsschrift „Über die Häufigkeit des Diabetes mellitus im Heer“ wollte Benn als aktiver Militärarzt wirken, wurde wegen einer Wanderniere zunächst jedoch nicht angenommen. Während des Ersten Weltkrieges setzte man ihn trotz seines Leidens als Sanitätsoffizier ein, er ließ sich aber schon vor Kriegsende 1917 in Berlin als Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten nieder. Zunächst unter dem Einfluss von Else Lasker-Schüler (1869 bis 1945), mit der er ein Liebesverhältnis hatte, dem Expressionismus zugewandt, begann Benn in den 20er-Jahren mit einer »radikal-avantgardistischen Erneuerung des Vokabulars« (1). Benn gewann zunehmend Geltung im literarischen Berlin, obgleich er der von Johannes R. Becher (1891 bis 1958) und Egon Erwin Kisch (1885 bis 1948) geforderten Sozialkritik seinen »tragisch-heroischen Geschichtspessimismus« entgegensetzte. Nach anfänglicher Annäherung an die Nationalsozialisten widerte ihn der »Dreck« schon 1933 an, und Benn ging in die innere Emigration (1).
Benns Stellung im literarischen Berlin charakterisierte Alfred Döblin (1878 bis 1957), Arzt und Literat wie Benn, 1932 zutreffend:
»Ich habe Benn vorzustellen […]. Ich tue das umso lieber, als er 3facher Kollege ist Schriftsteller, Arzt, Akademiker, – dazu in Berlin – er ist Repräsentant eines Geisteszustandes von heute.« (12)
Den »Geisteszustand von heute«, auf den Döblin anspielt, spiegeln auch Benns Kokain-Gedichte (13) wider, die allerdings bereits während des Ersten Weltkriegs entstanden waren. Beide Gedichte, „O Nacht“ und „Kokain“, sind medizinisch interpretiert worden, und zu Recht hat Friedrich Wilhelm Wodtke darauf hingewiesen, dass sich Benn »wohl bewußt – in die literarische Tradition der `Drogendichtung´ eingereiht hat« (14). So schrieb also nicht der »Analytiker« Benn, sondern der Literat:
»Cocain
Den Ich-zerfall, den süßen, tiefersehnten,
Den gibst Du mir: schon ist die Kehle rauh,
Schon ist der fremde Klang an unerwähnten
Gebilden meines Ichs am Unterbau.
Nicht mehr am Schwerte, das der Mutter Scheide
Entsprang, um da und dort ein Werk zu tun
Und stählern schlägt –: gesunken in die Heide,
Wo Hügel kaum enthüllter Formen ruhn!
Ein laues Glatt, ein kleines Etwas, Eben –
Und nun entsteigt für Hauche eines Wehns
Das Ur, geballt, Nicht-seine beben
Hirnschauer mürbesten Vorübergehns.
Zersprengtes Ich – o aufgetrunkene Schwäre –
Verwehe Fieber – süß zerborstene Wehr -:
Verströme, o verströme Du – gebäre
Blutbäuchig das Entformte her.«
Polytoximane Dichter
Undenkbar sind die polytoximanen Dichter ohne die Cafés, die sie frequentierten. Auch Ernst Jünger kannte sie (4):
»Ich hatte die Larvengesichter mit den Nachtschattenaugen in den Cafés gesehen, nicht nur am Alexanderplatz, sondern auch am Kurfürstendamm. Ein widriger Anblick, obwohl er in jenen Jahren nicht selten war. Wenn etwas nicht in die dynamische Welt gehörte, so war es diese völlige Starre und Ausdruckslosigkeit.«
Bereits zu Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich an der Ecke Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße das »Café des Westens« etabliert, das bald als »Café Größenwahn« bekannt werden sollte. Hier verkehrte »tout Berlin«, vor allem aber waren hier Künstler und Literaten zu Gast. Nach dem Umzug in neue Räume verlor das »Café Größenwahn« seine Attraktion, und nach dem Ersten Weltkrieg siedelte die Bohème ins »Romanische Café« über, das auch in den 20er-Jahren seine Stellung gegenüber anderen Cafés behaupten konnte. Günther Birkenfeld beschrieb es in seinem „Wartesaal des Genius“ (15):
»Das Lokal selbst war so farblos und frostig wie sein Name, abgeleitet von der spätwilhelminischen Romanik rund umher. Hier traf sich alles, was zwischen Rejkjavik und Tahiti von Beruf oder aus Liebhaberei mit den Musen und Grazien in irgendeiner Beziehung stand.«
Hier verkehrte, wie auch schon im »Café Größenwahn«, der expressionistische Dichter Walter Rheiner, ein Exponent des Polytoximanen. 1895 in Köln als Walter Schnorrenberg geboren – den Namen gab er 1911 zugunsten des Pseudonyms »Rheiner« auf – erlebte er die Hölle des Ersten Weltkriegs an der Ostfront und wurde zum Morphinisten. Seit 1917 lebte er nachts in Berliner Pensionen, tagsüber in Kaffeehäusern; zu dieser Zeit entstand auch seine Novelle „Kokain“ (17).
»Er war, wie immer, richtig stehengeblieben.
„Nachtglocke zur Apotheke“. Also geschellt und warten. Da wurde das Licht entzündet, das Klapptürchen ging auf. Der Apotheker streckte den kahlen Kopf heraus. „Herr Doktor…“ „Na, schon wieder da? … Können Sie denn nicht eher kommen?“ „Bitte um Entschuldigung, ich hatte…“ Aber die Glatze war schon fort. Ja, was hatte er? Er hatte gekämpft, wie fast jeden Abend und war, wie immer, unterlegen. Ein großes Achselzucken über die ganze Welt! Der Apotheker erschien wieder: „Drei Mark fünfzig.“ Tobias murmelte: „So viel habe ich nicht.“ „Na, gut“, sagte der Apotheker, „ich werd’s noch mal aufschreiben, aber wehe, wenn Sie nicht zahlen: Sie wissen ja!“ „Danke schön“, flüsterte Tobias. „Guten Abend.“ Nun war kein Sinnen mehr und keine Gedanken, keine Sorge und keine Frage, da er das ewige Gift in den Händen hielt, die sich wie zum Gebet um die kleine sechseckige Flasche falteten. Er selbst war das Leben jetzt, und sein Herz übertönte die Welt! Im Café, auf der Toilette, gab er sich drei Injektionen hintereinander, verschloß Flasche und Injektionsspritze wieder sorgfältig und steckte alles in die Hosentasche. Nun fühlte er sich frei und leicht, spielerisch, ein junger Gott!«
1918 heiratete Rheiner und zog nach Dresden, verließ jedoch, gezeichnet von der Sucht, Frau und Kinder und flüchtete nach Köln. Obgleich seine Mutter ihn 1925 zu einer Entziehungskur nach Bonn schickte, kehrte er noch im gleichen Jahr nach Berlin zurück, wo er sich nach einer Überdosis Morphium aus dem Fenster im dritten Stock eines Hauses stürzte und starb (18).
Sein Freund Conrad Felixmüller (1897 bis 1977), der unter anderem auch die Novelle „Kokain“ illustriert hatte, setzte ihm mit dem Ölgemälde »Tod des Dichters Walter Rheiner« ein Denkmal.
Ein weiterer Berliner Polytoximane war John Hoexter, der »Dante des „Romanischen Cafés“« (20). Hoexter stammte aus Hannover und ging bereits in jungen Jahren nach Berlin. »Sein poetisches Werk blieb schmal« (1), aber seine als Privatdruck veröffentlichten „Apropoésies Bohèmiennes“ zeigen ihn als Expressionisten mit sprachparodistischen, auch dadaistischen Wortwitzen. Bekannt wurde er vor allem als Kaffeehausbesucher, und so blieb die Erinnerung an sein Auftreten (20):
»„Jeder“ – so berichtete Herbert Günther – „kannte den schmalen, eingefallenen Mann, der dort alltäglich das Feuilleton der Zeitung durchblätterte und dann die Runde machte, um bei dem einen oder anderen seiner vielen freiwillig-unfreiwilligen Mäzene zu kassieren, was er nicht nur für den Kaffee brauchte, sondern vor allem für das stärkere Gift, dem er untertan war, das Morphium; außerdem musste von Zeit zu Zeit eine Entziehungskur finanziert werden. Viele Stammgäste hatten ihren festen Satz, den sie Höxter regelmäßig entrichteten, einige angeblich sogar im voraus, wenn sie verreisten.“
Auch Rudolf Ditzen (1893 bis 1947), der unter dem Pseudonym Hans Fallada das klassische Werk „Der Trinker“ schrieb, hielt bis zu seinem Tode an der Morphiumspritze fest, die auch sein Leben in der frühen DDR bestimmte (21).
Die Tänzerin
Neben den Cafés waren es vor allem die Kabaretts, die Berlins Glanz am Künstlerhimmel erstrahlen ließen. Auch hier waren Morphin und Kokain stets präsent: Während Mischa Spolianski Schlager wie »Morphium« komponierte,
„dachte Theo Oppermann […]: Wo ein Nacktballett reussiert, kann auch ein zweites leben. Er attachierte sich eine hübsche, schlanke, blonde Tänzerin mit ein paar netten Mädchen. Seine Freundin nannte er Salome. Tanzte Celly „Morphium“, so tanzte das Salomeballett, wie es firmierte, “Opium“. Ein Scheich und seine Odalisken hüpften um eine Opiumpfeife herum. Zweiter Aufguß des Vorbilds. Der „Schwarze Kater“ legte sich vis-à-vis an der anderen Ecke der Friedrichstraße im ersten Stock, wo es auch das Passagepanoptikum gab, eine Filiale zu: die „Weiße Maus“. Sie eröffnete mit dem Salomeballett. Das Geschäft blühte hier wie dort.“ (9)
Unübertroffen war allerdings die Tänzerin Anita Berber (1899 bis 1928), die mit ihrem zweiten Mann Willy Knobloch aus Chemnitz, der sich bald das Pseudonym Sebastian Droste zulegte, auch das Kokain kennen gelernt hatte. Anita Berber stammte aus einer Dresdner Künstlerfamilie und schlug gleichfalls eine Künstlerkarriere ein. Nach dem Ballettunterricht reüssierte sie auf Berliner Bühnen, spielte in einigen Filmen mit und wurde von Otto Dix (22) und Paul Kamm porträtiert. Perfekt im Ausdruckstanz, stieg sie in den 20er-Jahren zu einer der gesuchtesten Tänzerinnen in Berlin auf. Allerdings konnte sie die Auftritte wohl nur durch einen nicht unerheblichen Kokaingenuss bewältigen, der bald zur Abhängigkeit führte. Nach der Musik von Camille Saint-Saëns tanzte Anita Berber „Kokain“ nach einem eigenen Gedicht (23):
»Wände
Tisch
Schatten und Katzen
Grüne Augen
Viele Augen
Millionenfache Augen
Das Weib
Nervöses zerflatterndes Begehren
Aufflackerndes Leben
Schwälende Lampe
Tanzender Schatten
Kleiner Schatten
Großer Schatten
Der Schatten
Oh – der Sprung über den Schatten
Er quält dieser Schatten
Er martert dieser Schatten
Er frißt mich dieser Schatten
Was will dieser Schatten
Kokain
Aufschrei
Tiere
Blut
Alkohol
Schmerzen
Viele Schmerzen
Und die Augen
Die Tiere
Die Mäuse
Das Licht
Dieser Schatten
Dieser schrecklich große schwarze Schatten.«
1924 lernte Klaus Mann (1906 bis 1949) die Tänzerin kennen und schilderte ihren einsetzenden körperlichen Verfall (24):
»Achtzehnjährige erschüttert ein solches geschminktes Gesicht. Ihr Gesicht war eine düstere und böse Maske. Der stark geschwungene Mund, den man sah, war keineswegs ihrer, vielmehr ein blutigrotes Machwerk aus dem Schminktöpfchen. Die kalkigen Wangen hatten violetten Schimmer. An den Augen mußte sie täglich eine Stunde mindestens arbeiten. – Sie sprach ununterbrochen und sie log furchtbar. Es war klar, daß sie sehr viel Kokain genommen hatte; sie bot auch mir welches an. […] Sie erzählte mit einer heiseren Stimme die unglaubhaftesten Abenteuer; von Tieren, die sie hypnotisiert, von Mördern, denen sie geschickt ausgewichen. Dabei blieb die bittere Maske, die ihr Gesicht war, im Halbdunkel unbewegt.«
Nach einer Orientreise brach Anita Berber 1928 zusammen und wurde in das Kreuzberger Bethanien-Krankenhaus eingeliefert. Lazar Hermann alias Leo Lania, der 1929 einen biografischen Roman über die Tänzerin verfasste, schildert ihr Ende (25):
»Die Frau, die an einem Novembermorgen ins Bethanien-Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte kaum noch Ähnlichkeit mit Anita. Zum Skelett abgemagert, so saß sie, die Beine hochgezogen, im Bett – sie konnte sich nicht mehr ausstrecken –, sitzend hustete sie unter gräßlichen Qualen ihre Lunge aus. Am Kopfende ihres Bettes waren die letzten Getreuen ihres Lebens versammelt […] ihre letzte Zuflucht: die Morphiumspritze und eine Sammlung von Madonnen- und Christus-Statuetten. Im Grunde war Anita immer sehr fromm gewesen, voller Scheu, es sich selbst einzugestehen. Nun flüchtete sie ins Gebet. Wenn das nicht half, mußte die Morphiumspritze heran. Sie mußte sehr oft heran.«
Wir kommen zu einem Abschluss unserer Reise durch die Süchte und Sehnsüchte Berliner Literaten, den Gottfried Benn (13) setzte:
»Abschluß
Nachts in den Kneipen, wo ich manchmal hause
Grundlagenlos und in der Nacktheit Bann
wie in dem Mutterschoß, der Mutterklause
einst, welternährt, kommt mich ein Anblick an.
Ein Herr in Loden und mit vollen Gesten,
er wendet sich jetzt ganz dem Partner zu,
verschmilzt mit Grog und Magenbitterresten:
Sie streben beiden einem A b s c h l u ß zu.
Ach ja, ein Abschluß, wenn auch nur in Dingen,
die zeitlich sind, besiegelbar durch Korn:
Hier ist ein Endentschluß, hier ist Gelingen,
sie saugen tief das Glas, sie liegen vorn –
mir steht ein Meer vor Augen, oben Bläue,
doch in der Tiefe waberndes Getier,
verfratzte Kolben, Glasiges, – ich scheue
mich, mehr zu sagen und zu deuten hier.«
Glossar
Semiotisch, Semiologie: Lehre von den Zeichen
Cento: Gedicht, das aus den Teilen anderer Gedichte zusammengestellt wurde; Gedichtform des 16. Jahrhunderts
Entomologie: Insektenkunde
Cicerone: Fremdenführer
Luzidität: Leuchtkraft
Adept: Anhänger, Gefolgsmann/frau
Sigle: festgelegtes Abkürzungszeichen
Odaliske: weiße türkische Haremssklavin
Literatur
- Killy, W. (Hrsg.), Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 15 Bde. Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh und München 1988 – 1993.
- Plättner, P. (Bearb.), Vom Schreiben 3: Stimulanzien oder Wie sich zum Schreiben bringen? Mit einem Essay von Peter Rühmkorf. Deutsche Schillergesellschaft, Marbach am Neckar 1995 (Marbacher Magazin 72/1995).
- Wiesemann, C., Die heimliche Krankheit. Eine Geschichte des Suchtbegriffs. frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstadt 2000.
- Jünger, E., Essays V. Annäherungen. 2. Ausg. Klett-Cotta, Stuttgart 1998 (Ernst Jünger. Sämtliche Werke. 2. Abt. Essays. Bd. 11. Essays V).
- Krüger, M., Alkohol und Literatur. Cotta’s kulinarischer Almanach 1996/97. Klett-Cotta, Stuttgart 1995, S. 140 – 145.
- Vleuten, C. F. van, Dichterische Arbeit und Alkohol. Eine Rundfrage. Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literaturfreunde 9 (1906), Sp. 81 – 146.
- Dumitriu, H., Die wissenschaftliche Entwicklung der Alkaloid-Chemie am Beispiel der Firma Merck in den Jahren 1886 – 1920. Rer. nat. Diss. Heidelberg 1993.
- Maier, H.W., Der Kokainismus. Geschichte/Pathologie. Medizinische und behördliche Bekämpfung. Georg Thieme Verlag, Leipzig 1926.
- Marcus, P. E., Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Aus Berlins glanzvollsten Tagen und Nächten. Lothar Blanvalet Verlag, Berlin 1952.
- Richter, L. (Hrsg.), Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Berliner Gassenhauer. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1977.
- Zuckmayer, C., Als wär’s ein Stück von mir. Horen der Freundschaft. S. Fischer, Frankfurt/Main 1966.
- Gottfried Benn 1886 – 1956. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs. Marbacher Kataloge 41, 3. durchges. Aufl. Marbach am Neckar 1987 .
- Benn, G., Gedichte in der Fassung der Erstdrucke. Mit einer Einführung. Hrsg. von Bruno Hillebrand. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1988 (Fischer Taschenbuch 5231).
- Wodtke, F. W., Gottfried Benns Drogengedichte. stichwort 3 (1973) 216 – 223; stichwort 4 (1973) 256 – 267.
- Thiele-Dohrmann, K., Europäische Kaffeehauskultur. Artemis & Winkler, Düsseldorf, Zürich 1997.
- Barth, P. (Hrsg.), Conrad Felixmüller. Die Dresdener Jahre 1913 – 1933. Düsseldorf 1987.
- Rheiner, W., Kokain. Schrei in die Welt. Expressionismus in Dresden. Hrsg. von Peter Ludewig. Arche, Zürich 1990, S. 92 – 113.
- Kothes, M., Der Dichter an der Nadel. Walter Rheiner – Expressionist und Großstadtsklave. Michael Kothes Literarische Abenteuer. Dreizehn Portraits. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996 (suhrkamp taschenbuch 2512), S. 85 – 95.
- Spielmann, H. (Hrsg.), Conrad Felixmüller. Monographie und Werkverzeichnis der Gemälde. Wienand, Köln 1996.
- Bergmann, A., John Hoexter. Ein Denkstein. Detmold 1971 (19. Jahresgabe der Grabbe-Gesellschaft).
- Crepon, T., Leben und Tode des Hans Fallada. Mitteldeutscher Verlag Halle und Leipzig 1979.
- Karcher, E., Eros und Tod im Werk von Otto Dix: Studien zur Geschichte des Körpers in den zwanziger Jahren. Lit-Verlag Münster 1984 (Kunstgeschichte: Form und Interesse; Bd. 7).
- Fischer, L., Tanz zwischen Rausch und Tod. Anita Berber 1918 – 1928 in Berlin. Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1984.
- Mann, K., Erinnerungen an Anita Berber. Die Bühne 7, Nr. 275 (1930), 43 – 44.
- Herman, L., Der Tanz ins Dunkel. Anita Berber. Ein biographischer Roman. Berlin 1929.
Die Autoren
Angela Reinthal wurde 1966 in Berlin geboren und wuchs in Michelstadt/Odenwald auf. Dort machte sie auch ihr Abitur und absolvierte eine Ausbildung zur Steuerfachgehilfin. 1988 begann sie mit dem Studium der Germanistik und Europäischen Kunstgeschichte in Heidelberg, 1999 wurde sie promoviert mit einer Dissertation über den Berliner Dichter Ernst Blass. Von 2000 bis 2002 war Angela Reinthal wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Finanz- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg und zuständig für die Erstellung der Briefedition Ernst Forsthoff – Carl Schmitt. Seit 2000 Assistentin am Hermann-Schelenz-Institut für Pharmazie- und Kulturgeschichte in Heidelberg ist Reinthal seit 2001 auch am Deutschen Literaturarchiv in Marbach/Neckar tätig.
Wolf-Dieter Müller-Jahncke schloss seine Studien der Pharmazie, historischen Hilfswissenschaften, mittelalterlichen Geschichte und lateinischen Philologie des Mittelalters 1973 mit der Promotion ab. 1982 habilitierte er sich an der Philipps-Universität Marburg für das Fach Geschichte der Pharmazie. 1986 wurde er zum Honorarprofessor an der Universität Marburg und 1988 an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ernannt. Seit 1988 vertritt er an der dortigen Fakultät für Pharmazie die Fachrichtung Geschichte der Naturwissenschaften und Pharmazie. Von 1986 bis 1997 war Professor Müller-Jahnke Kurator des Deutschen Apotheken-Museums; seit 1998 leitet er das von ihm gegründete Hermann-Schelenz-Institut in Heidelberg. Er hatte und hat hohe Ämter in Fachgesellschaften inne, so war von 1993 bis 1995 Präsident der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte und ist seit 2001 Präsident der Académie Internationale d´Histoire de la Pharmacie.
Anschrift der Verfasser:
Professor Dr. W.-D. Müller-Jahncke
Hermann-Schelenz-Institut für Pharmazie- und Kulturgeschichte in Heidelberg e. V.
Friedrichstraße 3
69117 Heidelberg
Dr. phil. Angela Reinthal M. A.
Schlosserstraße 4
69115 Heidelberg![]()
© 2003 GOVI-Verlag
E-Mail: redaktion@govi.de